IPA Journal 01/2025
Kongresse
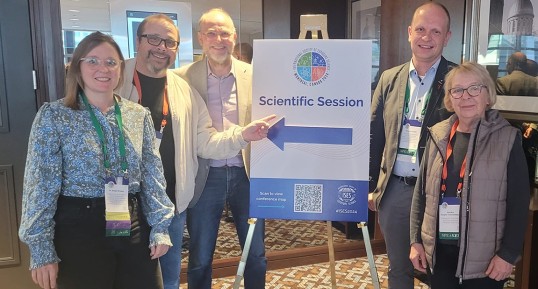
Das IPA-Team auf der ISES-Jahrestagung: Dr. S. Wrobel, Dr. H.M. Koch, Dr. H.U. Käfferlein, S. Koslitz, Dr. M. Kasper-Sonnenberg (v.l.n.r.)
Bild: privat
Jährliches Treffen der „International Society of Exposure Science“
Vom 20. bis 24. Oktober 2024 fand die 34. Jahrestagung der „International Society of Exposure Science“ (ISES) in Montréal, Kanada, statt. Der Fokus lag in diesem Jahr auf Untersuchungen von mit Gefahrstoffen belasteten Bevölkerungsgruppen. Für die Tagung kamen etwa 850 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der ganzen Welt aus den Bereichen der Expositionswissenschaft, Epidemiologie, Toxikologie und Risikobewertung zusammen.
In insgesamt acht Parallelsitzungen wurden zahlreiche Beiträge zu aktuellen Forschungsthemen präsentiert. Auch der Bereich Human-Biomonitoring des IPA war mit mehreren Beiträgen vertreten. Dr. Monika Kasper-Sonnenberg, IPA, berichtete über die Ergebnisse zum zeitlichen Verlauf der Weichmacher-Exposition in Deutschland ab den 80er Jahren bis heute. Dr. Sonja Wrobel, IPA, referierte über die Neonikotinoid-Konzentrationen in Kinderurinen aus verschiedenen asiatischen Ländern im Vergleich zu Deutschland. Neonikotinoide sind mit Abstand die größte Gruppe von Pflanzenschutzmitteln mit neurotoxischer Wirkung. Stephan Koslitz, IPA, präsentierte Ergebnisse zu Naphtholkonzentrationen im Urin von Beschäftigten in Kokereien. Dr. Holger M. Koch, IPA, stellte die aktuellen Daten zu dem in der Europäischen Union verbotenen, aber dennoch in Urin gefundenen, Weichmacher Di-n-hexylphthalat (DnHexP) vor. Die Ergebnisse waren auch Thema einer gemeinsamen Vortragsrunde mit dem Titel “Der DnHexP-Krimi“. Hier referierten auch Kooperationspartner des IPA, darunter Dr. Nikola Pluym vom analytisch-biologischen Forschungslabor in Planegg, Dr. Aline Murawski, Umweltbundesamt, Berlin und Dr. Martin Kraft, Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW. In der anschließenden Diskussionsrunde zu diesem Thema gab es viele positive Rückmeldungen zu der fundierten Aufarbeitung der Problematik. Einmal mehr habe sich gezeigt, so die Teilnehmenden des Workshops, dass belastbare Forschungsergebnisse vor allem durch gut etablierte Kooperationen auch sehr kurzfristig zustande kommen können.
Außerdem wurden erste Daten zu der vom Umweltbundesamt (UBA) durchgeführten Deutschen Umweltstudie zur Gesundheit (GerES) VI von Dr. Marike Kolossa-Gehring präsentiert. Dr. Nora Lemke, UBA, stellte neue Erkenntnisse zur Exposition von Per- und polyfluorierten Alkylverbindungen (PFAS) vor.
Ein weiterer interessanter Aspekt der Tagung war die Beurteilung von kumulativen Expositionen, insbesondere gegenüber kanzerogenen, mutagenen und reproduktionstoxischen Substanzen. Hier sind sich die Expertinnen und Experten noch nicht einig, welcher Ansatz am vielversprechendsten ist. Nur einfach additive Modelle scheinen in diesem Punkt nicht zum Ziel zu führen.
Die nächste Jahrestagung der ISES wird voraussichtlich im August 2025 in Atlanta, USA, stattfinden. Sie soll dann zusammen mit der Jahrestagung der „International Society of Environmental Epidemiology“ (ISEE) ausgerichtet werden.
Autoren
Dipl.-Chem. Stephan Koslitz
Dr. Sonja Wrobel
IPA
3. LongCovid-Kongress in Berlin
Am 25. November 2024 kamen zum dritten Mal rund 1.500 Expertinnen und Experten zusammen, um jüngste Forschungsvorhaben und -ergebnisse, Diagnostikverfahren sowie Therapieansätze zu LongCOVID zu diskutieren. Ziel dieses Austauschs war es, die Versorgung von Betroffenen zu gewährleisten und in Zukunft weiter zu verbessern. Daher widmete sich der 3. Long-COVID-Kongress der Frage: „Bedarfsgerechte Versorgung postinfektiöser Erkrankungen – Ein Problem von Generationen?“
Im Zuge der Corona-Pandemie ist deutlich geworden, dass postvirale Erschöpfungssyndrome zwar bekannt sind, ihre konkreten Ursachen aber bisher nicht geklärt werden konnten. Die Symptombildung ist vielfältig und reicht von Kopfschmerzen über Atemnot bis hin zu fortwährenden Geruchsstörungen und Muskelschmerzen. Im Vordergrund stehen Erschöpfung und eine hohe Belastungsintoleranz. Diese sogenannte Post-Exertionelle Malaise (PEM) bedeutet, dass es bei den Betroffenen schon nach kurzer körperlicher oder geistiger Betätigung zu anhaltender oder dauerhafter Verschlechterung der Beschwerden kommt.
In insgesamt sechs Themenräumen diskutierten Forschende, medizinisches Personal und Betroffene über die neuesten Ergebnisse, Forschungsansätze und Perspektiven.
Bundesgesundheitsminister Prof. Dr. Karl Lauterbach sprach zur Bedeutung von LongCOVID und anderen postinfektiösen Erkrankungen aus gesundheitspolitischer Sicht. Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) stellt zudem auf seiner Website ein umfangreiches Angebot zum aktuellen Forschungsstand zur Verfügung.
Immer wieder wurde herausgearbeitet, dass eine gute Diagnostik einen Meilenstein für die Behandlung darstellt, wobei die Differenzierung von Patientengruppen wichtig ist. Während bei einigen Patienten und Patientinnen Gefäßstörungen im Vordergrund stehen, sind Autoantikörper und damit das Bild einer Autoimmunkrankheit vor allem bei jüngeren Frauen typisch. LongCovid betrifft dabei nicht nur Personen, die einen schweren Verlauf der Viruskrankheit durchlitten haben. Diese Gruppe der Personen mit Intensivbehandlung ist ebenso gesondert zu betrachten, wie solche mit Vorerkrankungen, die sich im Zuge der Infektion verschlechtert haben und Kinder, die leider auch erkranken können.
Mit zwei Beiträgen zum Thema „PostCovid und Immunstatus“ präsentierte Dr. Verena Liebers aus dem IPA in Berlin erste Ergebnisse des gleichnamigen Projekts. Dabei stieß der Forschungsansatz des IPA, anhand von Entzündungsmarkern Untergruppen der Erkrankten zu bilden, auf großes Interesse.
Immunologische und neurologische Prozesse sind in unserem Körper eng verzahnt und müssen in der Behandlung mitbedacht werden. Die Stigmatisierung Betroffener, dadurch dass ihre Krankheit von außen nicht sichtbar ist und bisher klare Diagnosekriterien fehlen, ist eine weitere Herausforderung. Zudem belastet eine chronische Erkrankung die Psyche. Hier ist der Zugang zu entsprechenden Unterstützungsangeboten wichtig.
Ebenfalls thematisiert wurde die große Bedeutung von Information und Kommunikation, damit die vorhandenen Unterstützungsmöglichkeiten von Betroffenen auch ausgeschöpft werden können. Auch an schwer eingeschränkte Patienten muss dabei gedacht werden: Sie sind oft nicht in der Lage, das Versorgungssystem überhaupt in Anspruch zu nehmen, solange sie dafür weite Anfahrten in Kauf nehmen müssen.
Eine Aufzeichnung des Hauptprogramms der Veranstaltung findet sich unter: https://www.bmglongcovid.de/diskurs/long-covid-kongress.
Weitere Informationen: Bundesministerium für Gesundheit (BMG), www.bmg-longcovid.de
Autorin
Dr. Verena Liebers
IPA

